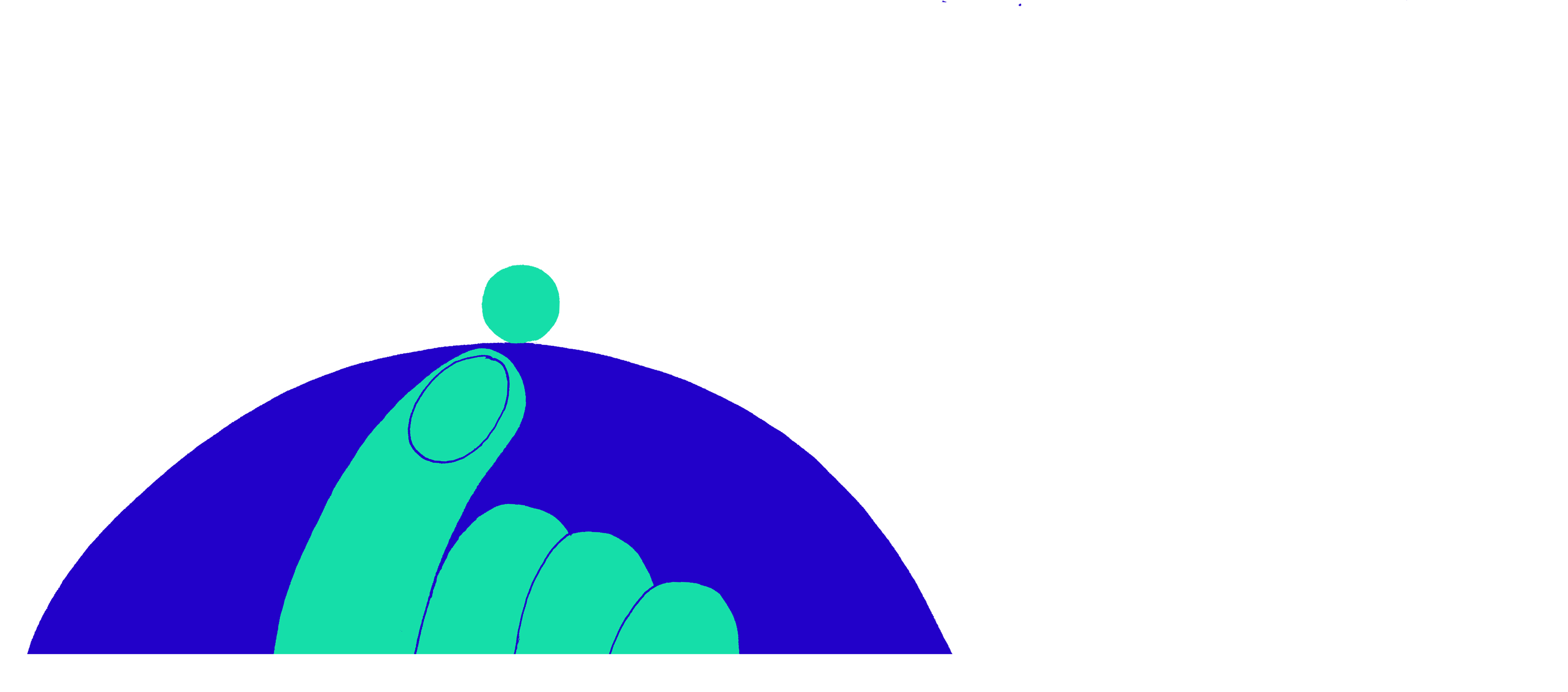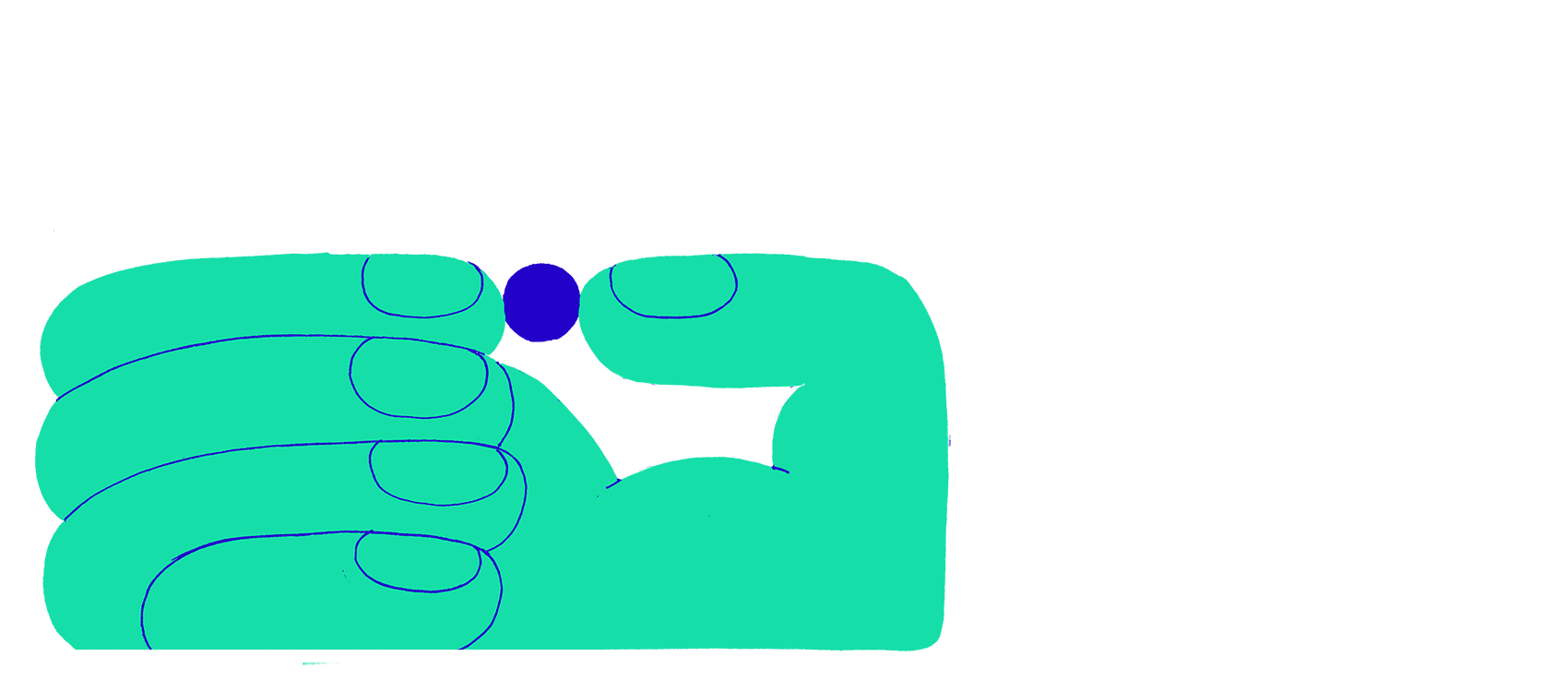Greta Hoheisel (GH): Daniela, Du bist als Kuratorin für Outreach im Brücke-Museum tätig, Noura, du als Referentin für transkulturelle Methodik in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ihr beide integriert – und deshalb sprechen wir heute – immer wieder Wissen, Erfahrungen und Narrative, die noch nicht im Museum verhandelt wurden. Welche Idee von Museum steckt dahinter, Noura?
Noura Dirani (ND): Es muss uns bewusst werden, dass Museen Orte der Repräsentation sind, die als solche Kunstgeschichte und Kultur sowie die Geschichtsschreibung selbst definieren und dabei oft Bezüge zur Alltagswelt und zur Lebenswelt des Publikums außer Acht lassen. Es geht um die Fragen: Wer wird eigentlich repräsentiert? Wessen Geschichten werden erzählt? An was erinnern wir uns als Kultur? Und was ist diese Kultur, in der dieser ganze Kosmos Museum stattfindet? Gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung und Digitalisierung und einem immer diverser werdenden Publikum, müssen wir uns diesen Fragen und Forderungen stellen. Auch deswegen, weil die Gegenwart, in der wir leben, in hohem Maße transkulturell ist. Diese Tatsache, so glaube ich, muss als Grundlage erst einmal allgemein anerkannt werden. In der Konsequenz muss das Museum als ein sozialer Ort stärker in den Blickpunkt rücken – als ein Ort des Dialogs. Es geht schlussendlich darum, dass das Museum ein Ort wird, der für viele Stimmen offen ist, der viele Stimmen anhört und an dem aufgrund der kritischen Reflexion der Vergangenheit, die eigene Gegenwart und vor allem die Zukunft gestaltet wird.
GH: Und aus welcher Haltung und Motivation heraus treibst Du Projekte voran, die das Museum stärker zu einem Ort des Dialogs machen?
ND: Meine Haltung basiert auf der transkulturellen Methodik. Ich komme ursprünglich aus der globalen Kunstgeschichte und bin dann als Referentin für transkulturelle Methodik an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gewechselt. Transkulturelle Forschung am Museum bedeutet, bisherige Klassifizierungen – also die Zuordnung von Objekten zu Epochen, zu Geografien sowie zu Kunstrichtungen – zu hinterfragen und vielmehr globale Beziehungsgeschichten zu analysieren: das Wandern von Ideen, Konzepten und Bildmotiven in den Blick zu nehmen. Da eignen sich die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im besonderen Maße, da wir ein Verbund von 15 Sammlungen sind, die durch alle Zeiten und Kulturen hindurch verschiedenen Kulturtechniken abbilden.
Dem Konzept der Transkulturalität liegt ein Kulturbegriff zugrunde, der in sich nicht abgeschlossen, sondern hybrid ist – und das schon seit jeher. Daher fokussiert die transkulturelle Perspektive auf den Interaktionsraum zwischen Gesellschaften und analysiert die wechselseitigen Auswirkungen. Innerhalb dieser Interaktionsräume werden Akteur*innen und Phänomene des Transfers sichtbar, die wiederum vielfältige Prozesse der Aneignung, Abgrenzung, Übersetzung, Anpassung oder Umschreibung aufdecken. Um genau dieses Aufdecken von Exklusionsmechanismen geht es bei der transkulturellen Forschung, um so eine Vielzahl an möglichen Geschichten, eine Vielzahl an möglichen Sichtweisen aufzuzeigen.
GH: Daniela, gab es eine Erfahrung, die Dich dazu veranlasst hat, den Museumsraum im Rahmen Deiner Arbeit immer wieder für Stimmen zu öffnen, die dort noch nicht vertreten sind?
Daniela Bystron (DB): Vieles meiner Haltung und meiner Motivation rühren aus meiner Biografie. Ich bin weiß, in Deutschland im Ruhrgebiet geboren und in einem Arbeiter*innenhaushalt großgeworden. Meine Eltern sind keine Akademiker*innen. Das spielt für mich eine große Rolle, weil ich dadurch zumindest immer noch die Fähigkeit habe, zu wissen, wie es ist, Dinge nicht zu wissen, gerade auf einem akademischen Level. Ich musste mir viele der kulturwissenschaftlichen Klassiker in meinem Studium erarbeiten, über die in anderen Familien vielleicht schon beim Abendessen diskutiert wurde. Ich finde diese Erfahrung sehr wertvoll – zu wissen, was man nicht weiß, welche Routinen man nicht kennt, welche unausgesprochen Regeln nicht klar sind. Kulturorte sind hierarchische, elitäre und exklusive Orte. Nicht-Wissen und nicht ausgesprochene Regeln spielen hier eine große Rolle. Das ist vielleicht auch das, was Du angesprochen hast, Noura, als Du gesagt hast, dass Du Exklusionsmechanismen sichtbar machen möchtest.
Kulturnutzungsstatistiken sind eine weitere Motivation für mich: Grob zusammengefasst, besagen sie, dass Museen und Kulturinstitutionen zu 80% von öffentlichen Geldern finanziert werden, aber gleichzeitig von der Bevölkerung sehr wenig genutzt werden. Ich finde es alarmierend, dass nur 10% der Bevölkerung Museen besuchen, viele davon sind sogar Mehrfachnutzer*innen. Das ist eine große Motivation für mich, da spüre ich eine große ungerechte Verteilung von Ressourcen.
GH: Welche Haltung steckt für Dich als Kuratorin für Outreach hinter dem Outreach?
DB: Mit den Kurator*innen für Outreach, die an unterschiedlichen Museen in Berlin arbeiten, haben wir gemeinsam versucht, eine Art „Haltung“ aufzuschreiben. Für uns war es sehr wichtig, dass Outreach und Inreach sehr stark zusammengedacht werden: dass es also nicht nur darum geht, sich um ein Publikum im Allgemeinen oder um ein Publikum, das sich nicht eingeladen fühlt, zu kümmern. Das wäre das Bild des Museums, das mit einem Krakenarm nach draußen greift, um die Leute hinein zu holen – ein komisches Bild. Vielmehr geht es uns darum zu sagen: es wird hier nichts passieren, die Leute werden nicht mehr kommen, sie werden sich auch nicht stärker für das Museum interessieren, wenn sich Prozesse im Inneren der Institution nicht ändern. Das hattest Du ja auch schon mit dem Begriff der Repräsentation angesprochen. Wer oder was ist repräsentiert? Wer fühlt sich mit seinen Themen dargestellt, gehört, gesehen, eingeladen? Mit seinen Interessen und seinen Lebensrealitäten? Hierarchien und dazugehörige Barrieren im Museum verhindern häufig, dass Inreach-Prozesse angegangen werden können. Häufig wird von der Museumsleitung in Frage gestellt, warum Inreach-Prozesse überhaupt eine Aufgabe der Vermittlung seien, da diese natürlich stark in Organisationsstrukturen eingreifen. Da habe ich Glück, da das Team des Brücke-Museums so klein ist, fällt es uns leichter, an den Inreach-Prozessen zu arbeiten und auch die Leitung ist sehr offen dafür.
Noch einen Punkt, den ich wichtig finde, Du hast ihn jetzt noch gar nicht so deutlich benannt – das Modewort: Diversität. Die Diversität der Berliner Bevölkerung ist null im Museum abgebildet, zumindest nicht bei den Personen, die Inhalte und Programme verantworten, dann schon eher bei Aufsichtspersonal, Garderobenkräften oder Künstler*innen. Wie wäre es denn möglich, die Diversität der Gesellschaft sowohl in den Inhalten als auch bei den Mitarbeiter*innen im Museum abzubilden? Und die Frage ist, wie kann man an diesem Ziel weiterarbeiten, wenn man nicht nur Inreach-Prozesse verantwortet, sondern sich auch um Programme und Inhalte kümmert? Man muss sich fragen: Mit wem arbeitet man zusammen? Wem gibt man Raum? Wem gibt man Gelder? Wem gibt man Ressourcen? Wie sind Strukturen gestaltet?
GH: Und Deine Idee von Museum, Daniela?
DB: Ein totaler Klassiker: Die Öffnung des Museums! Ich fand Deinen Begriff des hybriden Museums gut, Noura. Ich hätte gesagt: Das fluide Museum. Die Grenzen sind sehr starr, die Barrieren sind manifestiert. Ich wünsche mir einen organischeren, fluideren Umgang damit. Die neuen Regelungen im Museum, die wir momentan in der Pandemie erleben, bringen interessante Konsequenzen mit sich: einige Barrieren werden eingerissen, doch häufig führen sie zu mehr Exklusivität. Ich glaube aber, dass sich das ändern kann. Wir denken aktuell im Brücke-Museum darüber nach, die nächste Ausstellung nur sukzessive zu öffnen, weil sich die Daten für die Eröffnung immer wieder verschieben. Warum fangen wir nicht schon mal an zu öffnen und eröffnen dann nach ein paar Wochen den nächsten Teil? Es muss doch nicht alles von Anfang an fertig sein. Damit baut man ja auch ein Bild vom perfekten Museum mit perfekt verputzen Wänden auf. Man sieht überhaupt nicht, was hier passiert ist. Mit Einblicken in den Prozess wird das Museum vielleicht ein bisschen transparenter.
Was in der Literatur und in der Debatte überhaupt keine Rolle spielt, für mich aber sehr wichtig ist: ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Humor im Museum. Das finde ich wichtig, um nahbarer zu werden.
GH: Gehen wir einmal in die Praxis eurer Projekte. Noura, was ist Deine Rolle in den Projekten, in denen Du im „co-design“ Ausstellungen zusammen mit unterschiedlichen Personen und Gruppen kuratierst?
ND: Ich würde nicht sagen, dass ich im klassischen Sinne „nur“ Kuratorin bin. Genauso wenig bin ich im klassischen Sinne „nur“ Vermittlerin. Die kunsthistorische Auseinandersetzung mit den Objekten steht natürlich immer im Vordergrund, aber die Arbeit geht auch weit darüber hinaus, denn es geht um die Arbeit mit Menschen. Wichtig ist, dass wir uns vorab klar machen, dass wir viel mehr Zeit brauchen, um Dinge gemeinsam zu erarbeiten. Es geht darum, das Wissen der Menschen einzuholen und zu schauen, was sie brauchen und was sie interessiert. Das ist eine grundlegende Sache, die dem ganzen Prozess vorausgeht.
Bei der Ausstellung „Erfindung der Zukunft“ haben wir mit 500 Jugendlichen gearbeitet, haben sie gefragt: Was interessiert euch eigentlich? Welche Themen für die Zukunft sind für euch relevant? Über was sollen wir reden, was soll ausgestellt werden? Daraus hat sich die Raumfolge ergeben, die Objektauswahl und vieles andere. Das hatte zur Folge, dass wir ein neues und breiteres Publikum gewinnen konnten. Wir haben deutlich gemerkt, dass wir vor allem ein junges Publikum – durchschnittlich 25-jährig – hatten, die hier im Palais ihre Zeit verbrachten, ihre Hausaufgaben im Innenhof machten und in unserem Zero Waste-Café „abhingen“. Diese Räume für das Experiment und Prozessuale mussten aber erst einmal geschaffen werden. Die Direktion gibt uns hierzu die Freiheit, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Unter co-design verstehe ich, dass wir uns zuhören, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander versuchen zu eruieren, was die relevanten Themen sind – und das wirklich von Anfang an.
GH: Was sind die Herausforderungen in einem solchen Prozess?
ND: Das ist alles gar nicht so einfach, weil wir natürlich in eine klassische Museumsstruktur eingebunden sind. Nach innen muss man diese Projekte immer begründen, denn es gibt klare Abläufe, die einzuhalten sind und nur wenig Raum für kurzfristige Entscheidungen und Ideen lassen. Diese starren Abläufe lassen sich nur schwer auf die kooperativen Projekte applizieren, sie brauchen flexiblere Räume. Aktuell arbeiten wir am Projekt „Bau Dir Dein Museum“, ein Projekt mit unserem Jugendbeirat. Wir bekamen gemeinsam die Möglichkeit, hier im Palais einige Dinge zu etablieren, die nach Meinung der jungen Leute notwendig sind: zum Beispiel ein neues künstlerisches Leitsystem, das das gesamte Haus durchzieht. Die Jugendlichen haben sich Tape Art gewünscht und deswegen haben Tape Artists das ganze Haus in eine künstlerische Installation verwandelt. Weiter, so hat der Jugendbeirat formuliert, bräuchten wir eine Lounge, in der sich die Besucher*innen aufhalten können. Wir haben also eine Lounge eingerichtet und vieles, vieles mehr. Wir bauen das Museum nach den Wünschen derer um, die es nutzen.
Und dabei ist Diversität, über die Du, Daniela, schon gesprochen hast, eine der wichtigsten Herausforderungen. Wir müssen wirklich versuchen zu verstehen: Wer sind die Menschen, die hier leben? Wer sind die verschiedenen Gruppen, die nicht im Museum abgebildet werden und wie können wir sie einladen? Wie können wir ins Gespräch kommen? Wie können wir ihnen auch etwas anbieten? Zwischen der Hoch- und Soziokultur muss es eine stärkere Verbindung geben, wofür es passende Formate braucht. Darüber müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Deswegen die eingangs geschilderte Idee, dass diese klassische Trennung zwischen Kurator*innenschaft und Vermittlung überwunden werden muss: Wir müssen uns zusätzlich stärker in Sozialwissenschaften, in der Philosophie und in der Psychologie ausbilden, also in jenen Wissenschaften, die den Menschen betreffen.
GH: Daniela, nun hat Noura aus ihrer Perspektive schon über ihre Rolle und ihre Praxis gesprochen. Ich würde gerne noch auf Deine Arbeit mit den Fokusgruppen zu sprechen kommen.
DB: Die Arbeit mit dem Fokusgruppen geht nicht auf mich zurück. Ich habe sehr viel Inspiration, Kenntnisse und Anregung von Susan Kamel und Christine Gerbich bekommen, die beide im musealen Bereich forschen. Durch sie habe ich diese Methode kennengelernt. „Revisiting Collections“ ist eine britische Methode, die nicht für Kunstmuseen gedacht ist oder war, sondern eher für kleinere Stadt- und Regionalmuseen. Im Vordergrund steht die Idee, dass Wissen mehr ist als nur akademisches oder abfragbares Wissen, das im Museum meist vorherrscht. Ich nutze Fokusgruppen in meiner Arbeit oft als einen ersten Schritt. Wenn von mehreren Dimensionen der Partizipation gesprochen werden kann, ist es vielleicht eher eine Beratung. Hier wird noch gar nichts produziert, es können vielmehr unterschiedliche Meinungen eingeholt werden. Es geht darum, sich erstmal Stimmen anzuhören. Wenn ich mit unterschiedlichen Interessen-, Wissens- oder Erfahrungsgruppen gearbeitet habe, habe ich immer dafür gesorgt, dass es ein politisches Moment gab. Und zwar, dass „Entscheider*innen“ und Teilnehmer*innen in der Fokusgruppe zusammenkommen, aber die Fokusgruppenteilnehmer*innen wirklich als Expert*innen angesehen werden. Ich sende vorher immer ein Briefing an die Direktor*innen, an Politik, Senat und die Kurator*innen. Der erste Punkt ist immer: zuhören. Nicht kommentieren, nicht reden, nicht senden, sondern zuhören. Das kann das Museum ganz schlecht, nicht nur Sender zu sein. Ich habe gemerkt, dass dabei so viele interessante Dinge passieren. Das bekommen wir als Vermittler*in gar nicht hin. Ich höre zwar in meiner Arbeit mit Gruppen Kritik, Veränderungswünsche und viele Ideen, aber wenn ich diese ins Museum bringe, kommen sie nie so glaubhaft rüber, wie wenn die einzelnen Personen tatsächlich für ihre Sache, für ihre Belange selber sprechen.
GH: Wenn in den Fokusgruppen Wissen, das noch nicht im Museum vorhanden ist, produziert und zu gewissen Punkten repräsentiert wird – für wen ist dieses Wissen relevant?
DB: Die Frage, für wen das relevant ist, wird doch in anderen Bereichen des Museums auch nicht gestellt. Es wird selten angemerkt, dass es nur der kleine Akademiker*innendiskurs ist, den wir oft im Museum abbilden. Wenn wir fragen, für wen wir das machen, da finden sich schon Personen. Wir sind ja nicht alle nur eine Person oder eine Profession. Ich glaube, je breiter man das Wissen und die Zugänge ermöglicht, desto mehr Gelegenheiten gibt es, einen persönlichen Zugang zum Werk oder zum Inhalt zu bekommen. Das fehlt in vielen Museen.