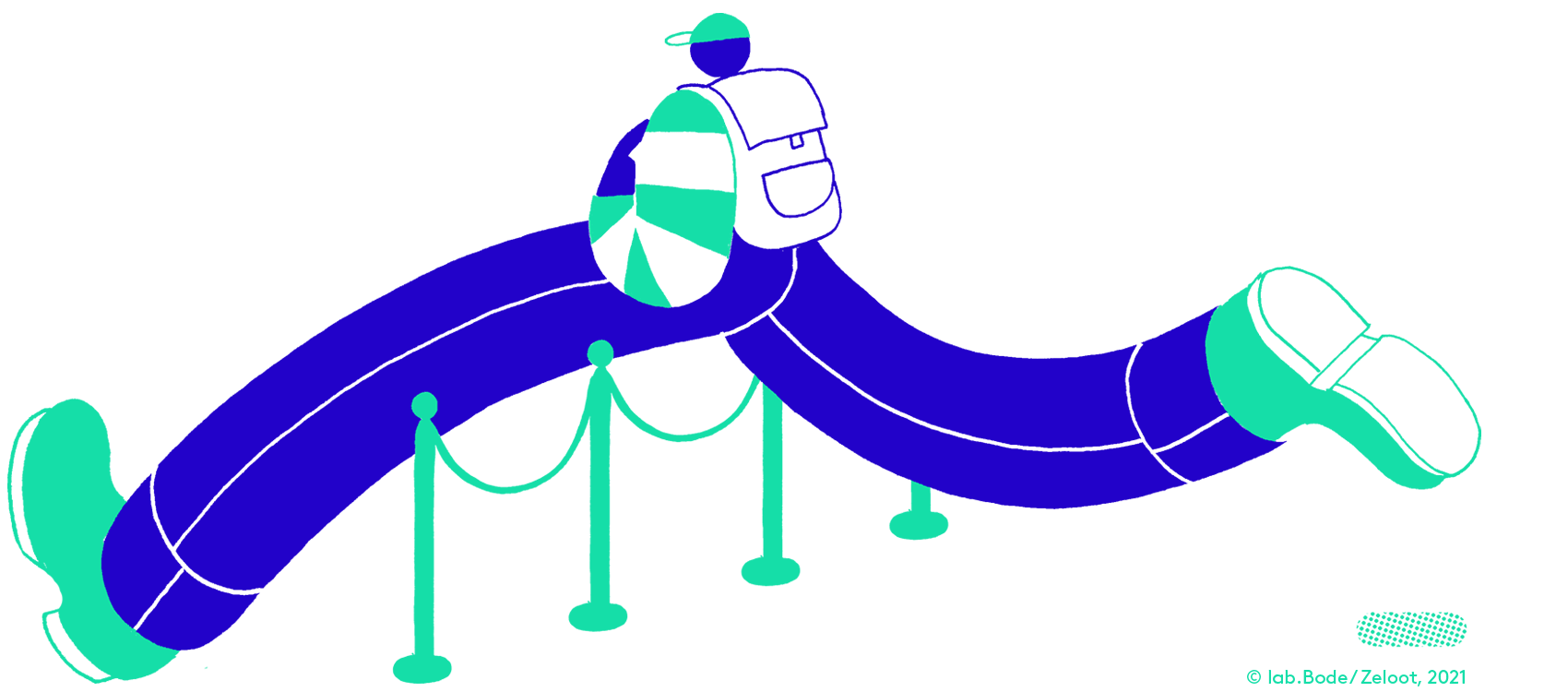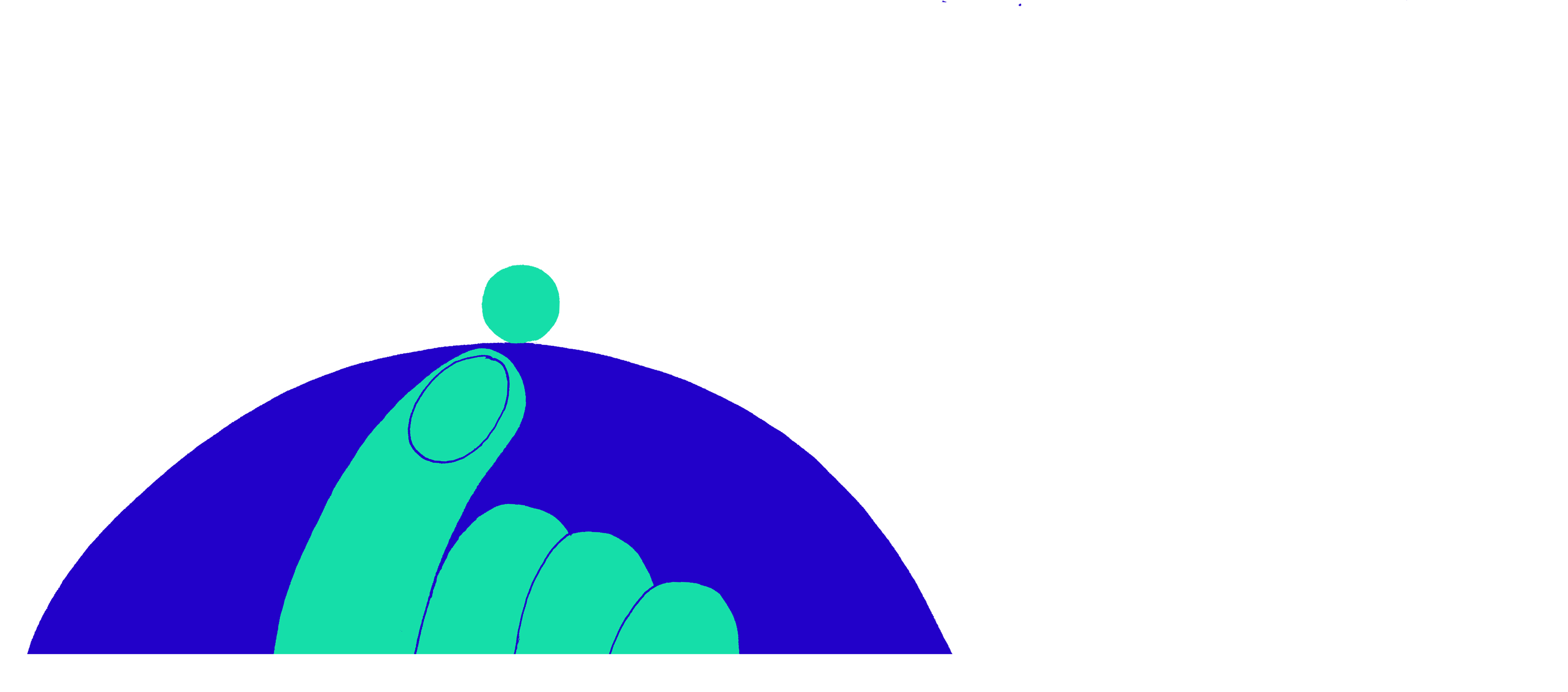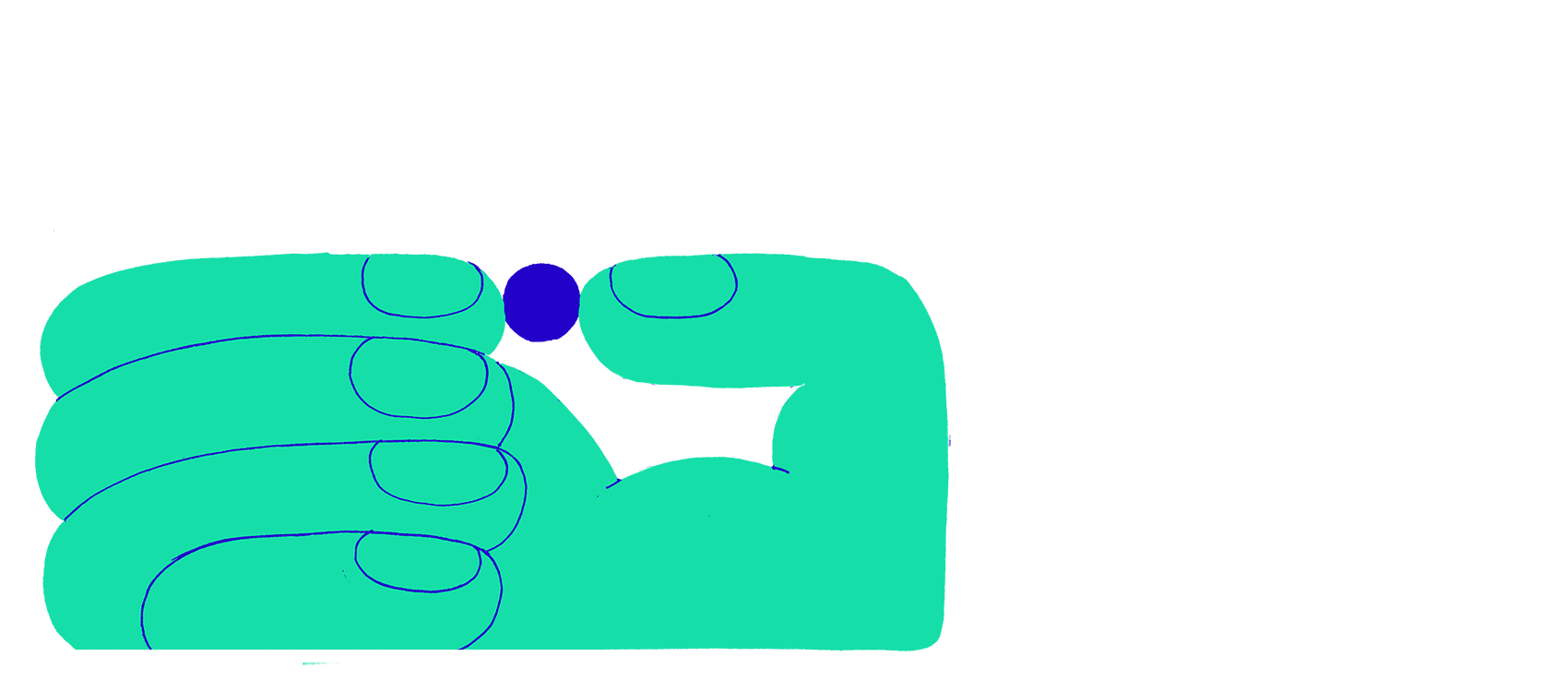Andrea Günther (AG): Hallo und herzlich willkommen! Heute treffen wir uns als bundesweites Netzwerk der Jugendgremien. Teil des Netzwerkes sind Charlotte Coosemans von der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Julia Moritz vom Gropius Bau – Ausstellungshaus der Berliner Festspiele und stellvertretend für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind Tony Hoyer und Anja Skowronski dabei sowie Andrea Günther für lab.Bode – Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen, angesiedelt im Bode-Museum.
Als Netzwerk organisieren wir uns seit 2020 und tauschen uns über die Neubildung von Jugendgremien in Ausstellungshäusern und Museen aus. In diesem Gespräch möchten wir unsere Erfahrung und unsere Netzwerkarbeit teilen und Unterschiede an den vier Häusern aufzeigen. Als Form der Darstellung haben wir uns im Folgenden für ein Gespräch entschieden, welches unterschiedliche Perspektiven und Voraussetzungen der Häuser aufzeigt.
AG: Liebe Julia, die erste Frage geht an Dich: Was ist die Motivation von Institutionen Jugendliche zu involvieren?
Julia Moritz (JM): Aus meiner Sicht ist die grundlegende Motivation für viele Institutionen, die mit Jugendgruppen arbeiten, ihre Besucher*innen in den Häusern zu diversifizieren und zu einer aktiven Teilhabe zu motivieren. Einerseits also einen Schritt weg vom normativen Standard, also die Gruppe männlicher weißer Menschen zwischen 30 und 60, hin zu Personengruppen, die wertvolle, substanzielle Beiträge in der Institution leisten können. Wenn man als Institution dieses Ziel verfolgt, dann wäre der zweite Schritt die Involvierung von Besucher*innengruppen über Kollaborationen, um auf Augenhöhe zu arbeiten. Essenziell dabei ist die individuelle Einbindung sowie Selbstbestimmung, die es den Gruppen ermöglicht eigenständig zu arbeiten.
AG: Was war Deine Motivation als Mitarbeiterin der Bildungsabteilung vom Gropius Bau an diesem Projekt? Was interessiert Dich an der Arbeit mit einem Jugendgremium?
JM: Meine persönliche Motivation ist eng mit dem Prinzip der Selbstbestimmung verbunden. Also mit der Motivation der Institution, bestimmte Autoritäten abzugeben und die Jugendlichen das Angebot eigenständig gestalten zu lassen und, dass die Erfahrungen aus der selbstbestimmten Arbeit zurück in die Institution fließen und neue Prozesse in Gang setzen. Also nicht nur in Richtung Outreach, sondern auch in Richtung Austausch und interne Vermittlung. Wir heißen am Gropius Bau Kurator*innen für Vermittlung, das heißt, wir sind in der kuratorischen Abteilung beschäftigt und keine wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, haben aber trotzdem ein großes wissenschaftliches Interesse. Meine Kollegin Jenny Sréter und ich möchten gerne zu diesem Diskurs der Inklusion, im weitesten Sinne, beitragen. Also wie die Identität eines Hauses vielstimmig gedacht und auch wirklich praktiziert werden kann und was wir von den Jugendlichen lernen können, um damit unsere eingefahrenen Denkweisen zu ändern.
AG: Was denkst Du, welche Expertise Jugendliche mitbringen und in das Haus einbringen können?
JM: Man geht zum Beispiel schnell davon aus, dass die sogenannten Digital Natives, mit digitaler Technik geborene Menschen, sofort auch technikaffin sind, aber das ist gar nicht unbedingt der Fall. Sie sind tatsächlich teilweise stärker am lebendigen sozialen Austausch interessiert als andere Besucher*innengruppen. Was sie als Expertise mitbringen, ist ein sehr großer Enthusiasmus für gemeinsames Zusammensein innerhalb der Institution, was für uns sehr wertvoll war. Zudem haben wir andere Dynamiken erlernt und das bedeutet nicht immer nur schneller, sondern eher eine Entschleunigung von den Strukturen der Institution. Man könnte sagen Jugendliche fordern von uns eine lebensnähere Prozessgestaltung ein. Das war ein wichtiger Lernprozess. Und schließlich ist mir noch der Punkt wichtig, dass sie sich sehr viel stärker fokussieren. Es ist weniger ein pflichtschuldiges Rezipieren, wir gehen durch die Ausstellung, wir sind jetzt hier, wir haben unser Ticket, wir schauen uns alles an. Sondern sie gehen ganz gezielt auf das zu, was für sie wichtig ist, was sie bewegt, was zählt, was sozusagen wirklich an sie rankommt. Und dann ist es auch egal, wenn sie die anderen drei Räume nicht gesehen haben. Dieser Fokus, dieser Mut zur Lücke und so ein sehr authentisches Interesse, ohne das jetzt verklären zu wollen, ist auch eine Expertise, von der wir in anderen Programmen sehr viel lernen konnten.
AG: Danke Julia für den Einstieg und ersten Überblick. Charlotte, möchtest Du aus dem Blickwinkel von einem kleineren Haus, dem Lenbachhaus in München, etwas ergänzen? Da gibt es vielleicht andere Bedingungen oder vielleicht andere Motivationen?
Charlotte Coosemans (CC): Ich glaube, dass der Freiraum der Kunstvermittlung am Lenbachhaus etwas ist, das das Haus ausmacht. Wir können ziemlich selbständig Projekte machen, die von den Kolleg*innen der anderen Bereiche anerkannt werden. Einen interessanten Aspekt, den Julia schon angefangen hat, zu beschreiben, würde ich als Reibungsmomente bezeichnen: Dass das System an sich, also das Gerüst der Institution sichtbar oder infrage gestellt wird. Zum Beispiel wenn Fragen kommen wie: Warum werden die Teilnehmenden der Jugendgremien bezahlt, wenn sie für die Institution arbeiten oder zu einer Diversität und Öffnung aktiv beitragen? In diesem Sinne sind Jugendliche in der Situation auch Expert*innen, die mit ihrer Erfahrungswelt zu Änderungen beitragen. Ich als Koordinatorin versuche, diese Anliegen zu realisieren und auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden zusammenzuarbeiten und Prozesse gemeinsam zu reflektieren. Die Rollen, die Macht, die Hierarchien müssen gemeinsam ausgehandelt und reflektiert werden, weil es ein Prozess ist, der gemeinsam gestaltet wird. Zum Punkt der Expertise möchte ich ergänzen, dass es stark von den einzelnen Mitgliedern abhängt, welche Fähigkeiten sie mitbringen. Es gibt keine*n Durchschnittsjugendliche*n. Darüber kommen wir schnell zum Thema Diversität und wie spreche ich Jugendliche an, dass sie Teil dieses Gremiums werden.
AG: Ich würde gerne die Punkte der Bezahlung und der gleichberechtigten Zusammenarbeit kommentieren. Das ist immer wieder in verschiedenen Gremien eine Frage: Bezahlte Praktika, Bezahlung für Jugendliche – ja oder nein? Natürlich ist monetäre Wertschätzung gerade im beruflichen Bereich wichtig und Bezahlung zeigt auch an, dass die Expertise und institutionelle Beratung, die junge Menschen im Rahmen ihrer Jugendgremienarbeit leisten, wertvoll ist. Andererseits entsteht mit Entlohnung auch ein gewisser Druck, bestimmte Arbeit leisten zu müssen. Dann kann das Jugendgremium zu einer Art Dienstleister werden, der in einem Arbeitsverhältnis mit der Institution steckt. Es birgt das Risiko, dass bezahlte Jugendbeteiligung dann kein freier und freiwilliger, künstlerisch-kreativer Ausdruck mehr ist. Denn wenn die Jugendlichen Geld bekommen, dann sind damit einhergehend auch institutionelle Erwartungen geknüpft, bestimmte Leistungen auch zu erbringen. Nicht in einem Vertragsverhältnis mit der Institution zu stehen kann auch davor bewahren, institutionalisiert zu werden und es ist unter Umständen leichter, Kritik zu äußern und Veränderungsprozesse von außen heranzutragen. Es muss daher gut abgewogen werden und ganz transparent mit den beteiligten jungen Menschen zusammen entschieden werden, ob und für welche Arbeit eine Entschädigung oder Bezahlung erfolgt.
CC: Ja, absolut. Bei uns wird die Arbeit als Ehrenamt deklariert. Ich finde es eine passende Form, auch wenn es den Stellenwert der Arbeit nicht gleichsetzt mit der Arbeit der Festangestellten. Gleichzeitig schafft das aber genau diesen Freiraum, weil die Ehrenamtspauschale nicht an eine spezifische Tätigkeit gekoppelt ist.
CC: Ich würde gerne zur zweiten Frage übergehen, die lautet: Welche Schritte sind notwendig, um einen Jugendbeirat beziehungsweise ein Jugendgremium aufzubauen? Wie hat die Ansprache und Gründung bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und im lab.Bode funktioniert? Anja möchtest Du beginnen?
Anja Skowronski (AS): Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben eine Werbekampagne explizit für das Jugendgremium erstellt. Wir haben mit dem Grafiker Kay Bachmann zusammengearbeitet und unterschiedliche Objekte aus den Sammlungen für die Motive ausgesucht. Geplant waren Flyer zum Auslegen, bedingt durch Corona haben wir uns dann ausschließlich auf die Sozialen Medien konzentriert und gezielt junge Menschen ab 16 Jahren angesprochen. Über öffentliche und gesponserte Beiträge ging die Kampagne online. Auch wenn sie zunächst nicht ausschließlich online geplant war, war diese Herangehensweise doch gut geeignet, um die Zielgruppe zu erreichen und konkret Workshops vor Ort zu bewerben. Mit der Nutzung der Sozialen Medien muss allerdings bedacht werden, dass Personen ohne technische Endgeräte und ohne Interesse an Museen mäßig erreicht werden. Über die gezielte Kommunikation mit Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Vereinen wurde versucht, eine größere Personengruppe zu finden. Da das Jugendgremium der SKD über das Outreach-Projekt „180 Ideen für Sachsen“ verankert war, wurden Workshops in ganz Sachsen veranstaltet. Die dadurch erreichten Menschen bildeten den Grundstock für die gezielte Ansprache von jungen Menschen. In der Umsetzung war es organisatorisch zu herausfordernd an unterschiedlichen Orten tätig zu sein und so haben wir uns geeinigt, die Treffen vor Ort in Dresden abzuhalten und die Fahrten dorthin zu finanzieren sowie anfänglich die Möglichkeit geboten, online zu den Treffen zu kommen.
CC: Und wie setzt sich das Jugendgremium aktuell zusammen?
AS: Die Mitglieder von Futur III, dem Jugendgremium der SKD, sind vom Ausbildungsgrad sehr durchmischt. Wir haben viele, die ein kulturelles Jahr absolvieren, einige, die gerade ihr Abitur machen oder gemacht haben und andere Personen sind berufstätig oder studieren. Als solches ist es aber schon eine an Kunst und Kultur interessierte Gruppe. Ziel ist es, dass Futur III sich an unterschiedlichste Menschen richtet. Dafür bedarf es weiterhin gezielte Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen, was durch den Online-Start zunächst nur begrenzt möglich war und jetzt fokussiert ausgebaut wird. Die jetzige Gruppe ist in kurzer Zeit zu einer Gemeinschaft geworden, zu der neue Personen jederzeit willkommen sind. Über die Projekte, an denen das Gremium mitarbeiten will, wird innerhalb der Gruppe demokratisch abgestimmt. Auf das Abstimmungsverfahren hat sich Futur III am Anfang eigenständig geeinigt und je nach Projekt wird unterschiedlich vorgegangen. Faktoren sind dabei Dringlichkeit, Interesse und Kapazität der einzelnen Personen. Neben Treffen im gesamten Gremium gibt es auch Projekte und Bereiche, in denen in Interessensgruppen gearbeitet wird. Das Ganze wurde von der Gruppe in einem sogenannten Selbstverständnis festgehalten, welches zentral für die Entscheidungsprozesse und das gemeinsame Miteinander ist und auf welches sich die Gruppe bei Unklarheiten berufen kann und gleichzeitig deren Stellung innerhalb der Institution stärkt.
CC: Und wie sieht es beim lab.Bode-Jugendgremium aus, Andrea?
AG: lab.Bode arbeitet seit über vier Jahren eng mit neun Partnerschulen aus Berlin zusammen. Eine davon ist das Thomas-Mann-Gymnasium im Märkischen Viertel am nördlichen Rand von Berlin. Die Schule hat eine sehr durchmischte Schüler*innenschaft mit einer großen Bandbreite an familiären Hintergründen. Seit 2016 haben wir sehr spannende und kritische Kunst- und Vermittlungsprojekte mit den Schüler*innen realisiert und gemeinsam Themen wie Mitbestimmung und Vielfalt im Museum bearbeitet. Es war daher naheliegend, mit einer Fokusgruppe von Schüler*innen des Thomas-Mann-Gymnasiums zu starten, um überhaupt Bedarfe und sinnvolle Strukturen für ein zukünftiges Jugendgremium der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) gemeinsam mit Jugendlichen zu entwickeln. Mit einer Gruppe von acht Schüler*innen, die sich im Zusatzkurs Museum engagieren, wurde das erste Pilot-Jugendgremium Youth Lab Berlin initiiert.
Zu Beginn waren Eeske Hahn und Julia Rocholl als junge Expert*innen für einen einwöchigen Peer to Peer-Einführungsworkshop eingeladen. Eeske und Julia engagieren sich seit der sechsten Klasse, seit über sechs Jahren, im Künstler*innenkollektiv Mit ohne Alles, das Jugendgremium der Ruhrtriennale war. Sie haben gemeinsam mit den Schüler*innen des Youth Lab Berlin eine Fortbildungswoche gehalten und mit ihnen Visionen und Ziele entwickelt.
Anschließend haben wir im Rahmen von lab.Bode und in Zusammenarbeit mit Judith Kirchner (einer freien Mitarbeiterin) dann ein halbes Jahr mit der Gruppe weitergearbeitet. In der Zeit entstand ein Forderungskatalog der Jugendlichen an die SMB und ein dreiteiliger Podcast zu Museums- und Veränderungsfragen.
Im Herbst 2020 haben wir dann die Fokusgruppe Youth Lab Berlin für alle Interessierten jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren geöffnete. Über Flyer in den Sammlungen der SMB und Werbung in den Sozialen Medien haben wir über vier Monate eine Rekrutierungsoffensive für neue Jugendgremiumsmitglieder betrieben. Über diese Aktion haben sechs neue Menschen zur Gruppe gefunden und aus der ersten Fokusgruppe sind zwei geblieben. Die neue Gruppe ist heterogen, in Bezug auf Klasse, Herkunft und Alter unterschiedlich zusammengesetzt. Das Alter liegt bei 17 bis 25, manche sind noch Abiturient*innen, die anderen im Bachelor- oder Masterstudium. Die meisten studieren im Kunst- und Kulturbereich, Ausstellungsdesign oder sind prinzipiell interessiert an Kunst und Kultur. Ich habe diese Gruppe dann zu einem Coaching eingeladen, um ein Selbstverständnis zu verfassen und eigene Visionen und Arbeitsformen zu generieren. Dies diente vor allem auch als teambildende Maßnahme und damit sich die jungen Menschen kennenlernen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln können. Die Pandemie hat das sehr erschwert. Wir haben uns dennoch alle zwei Wochen online getroffen und arbeiteten mit digitalen Spielen, Austausch- oder Kennenlernformaten und Visualisierungsplattformen, um es methodisch abwechslungsreicher zu gestalten. Das war eine große Herausforderung in der Zeit des Lockdowns, in der man persönlichen Kontakte reduzieren musste und nicht mehr in einem Raum sitzen durfte, so eine starke Beziehungsarbeit zu leisten. Gerade am Anfang ist Vertrauen gewinnen, Austausch, Verständnis füreinander und Teambuilding wahnsinnig wichtig, um überhaupt eine gemeinsame Stimme als Gruppe zu entwickeln.
JM: Also wir hatten ähnliche Erfahrungen. Alle Printprodukte bei Schulen und Partnerinitiativen sind nicht wahrgenommen worden. Wir konnten leider keine Werbemittel budgetieren und deswegen kamen tatsächlich alle Beteiligten in unserer ersten Sitzung über Freund*innen, Bekannte oder über Kommunikation unter den Jugendlichen. Das hat zu einer verhältnismäßig hohen Homogenität der Gruppe geführt. In fast allen Fällen bestand bereits Interesse an Kunst und Kultur, was nicht unbedingt eine große Diversität widerspiegelt. Das Alter der Gruppe liegt mit 15 bis 20 in einer ziemlich weiten Spanne, was uns sehr freut. Ein Grundvertrauen vonseiten der Teilnehmenden bezüglich der Institution hat uns bei den ersten Onlinetreffen sehr geholfen.
AG: Ich mache weiter mit einer Frage, die ich Tony stellen möchte. Welche Ressourcen und Strukturen werden benötigt, um ein Jugendgremium aufzubauen?
Tony Hoyer (TH): Ich denke, dass die wichtigste Ressource Mitarbeiter*innen sind. Es benötigt Menschen, die betreuen, organisieren und koordinieren. Vor allem am Anfang darf nicht unterschätzt werden, wie viel Zeit benötigt wird, bis eine Gruppe zusammenfindet. Damit ist die nächste wichtige Ressource die Zeit. Nicht nur Mitarbeiter*innen sind nötig, sondern auch deren Kapazität. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser Jugendgremium Interesse an vielen Aktivitäten hat. Das heißt, zu den eigentlichen Sitzungen kommen noch zusätzliche Runden dazu, die betreut werden müssen und der Zeitaufwand steigt eher als dass er sinkt. Zudem braucht die Gruppe eigene Räume, wenn es aus dem Digitalen herausgeht. Bei uns ist es zum Beispiel der Fall, dass sich die Jugendlichen einen Raum gewünscht haben, in dem sie eigenständig arbeiten können. Zudem bedarf es Lagerfläche, wo man Projektmaterialien aufbewahrt. Daraus resultiert der nächste Faktor: Geld. Das hatten wir vorhin schon als Punkt. Bei uns ist es so, dass die Jugendlichen nicht für ihr Mitwirken im Jugendbeirat vergütet werden, aber wir haben die Übereinkunft, dass sie eine Aufwandsentschädigung bekommen, wenn sie zum Beispiel von verschiedenen Abteilungen als junge Expert*innen angefragt werden. Darüber hinaus hat bei uns das Jugendgremium ein Budget bekommen, über das es selbst verfügen kann. Das heißt für Workshops oder eine Ausstellung im ländlichen Raum können sie, nach Absprache mit uns, selbst über ihr Budget verfügen und eigene Schwerpunkte setzen. Strukturell sollte von Anfang an geklärt sein, wie das Jugendgremium in der Institution oder in dem Haus verankert ist. Neben den organisatorischen Sachen ist es zentral, dass das Jugendgremium in der Institution vorgestellt wird und das nicht nur per Brief oder Mail, sondern auch persönlich. Und dann kann ganz schnell der Ansturm kommen, weil die Expertise doch offensichtlich sehr gefragt ist.
AG: Danke für den Einblick, Tony! Charlotte, was würdest Du aus Deiner bisherigen Erfahrung sagen: Welche Handlungsspielräume braucht es dafür, dass sich das Gremium möglich selbst repräsentieren kann? Und wenn Raum zur Selbstrepräsentation existiert, wie kommen die Systeme der Institution und des Gremiums zusammen?
CC: Wir sind auch dabei, wie es Tony erzählt hat, einzelne Personen des Lenbachhauses und des Kollektiv Crèmbach miteinander bekannt zu machen. Es gab ein offizielles Treffen, an dem das gesamte Team des Museums eingeladen war, das Gremium kennenzulernen. Das war ungefähr sechs Monate nachdem die Gruppe entstanden ist, zu einem Zeitpunkt, an dem schon eine Basis vorhanden war. Bei dem Treffen stellten wir fest, dass es hilfreich sein könnte, wenn sich einzelne Personen aus dem Haus mit dem Gremium treffen, um einander besser kennenzulernen und die Gespräche zu vertiefen. Wir sind dabei, mit den Sammlungsleiter*innen und dem Direktor Zoom-Meetings zu vereinbaren, damit die Mitglieder das Haus besser kennenlernen und die Konzepte hinter den Arbeitsstellen verstehen. Herausfordernd sind dabei unterschiedliche Zeitrhythmen. So eine Gruppe hat eine Eigendynamik und nicht die gleichen Kapazitäten wie Personen aus dem Haus, sie arbeiten nicht jeden Tag in der Institution. Dies muss berücksichtigt werden. Damit einher geht auch die Frage nach Qualität: Wenn eine Gruppe nach ihren Vorstellungen arbeiten soll, muss auch Kontrolle abgegeben werden und andere Ästhetiken und Formen zugelassen und akzeptiert werden.
TH: Bei uns ist es so, dass wir versuchen, die Teilnehmenden als Expert*innengremium zu etablieren, sodass sie zum Beispiel dazu beitragen können, Vermittlungsformate umzugestalten und jüngere Zielgruppen zu erreichen. Längerfristig gesehen setzen sie damit intern einen Denkanstoß in Gang und öffnen die Institution für neue Formate, zum Beispiel bei dem Projekt „Bau Dir Dein Museum“ im Japanischen Palais, an dem Jugendliche und das Gremium teilnehmen konnten und für ihre Ideen vergütet wurden. Es ging darum, ein neues optisches Leitsystem zu entwickeln. Es wurde mit der Kreativleitung des Japanischen Palais, Noura Dirani, gebrainstormt und im Anschluss die Ideen der Teilnehmenden umgesetzt. Die Jugendlichen haben sich unter anderem Neonfarben gewünscht und haben als Umsetzung Tape Art vorgeschlagen. Letztlich wurde das Berliner Kollektiv tape that eingeladen und hat mit Neon-Tape Art das Leitsystem im Palais gestaltet. Durch Projekte wie diese versuchen wir von den experimentelleren Räumen, wie das Palais eines ist, hin zu den klassischen Räumen, wie zum Beispiel das Residenzschloss, das Jugendgremium immer weiter zu integrieren. Und das hat, glaube ich, bei uns in der großen Institution mal mehr, mal weniger strenge Vorgaben, die vielleicht in kleineren Häusern nicht so eng gesehen werden. Die Zusammenarbeit insgesamt entsteht entweder so, dass die Jugendlichen Interesse an einem Thema äußern und wir organisieren die Umsetzung, zum Beispiel die Aufnahme eines Podcasts, oder dass Sammlungen auf den Jugendbeirat zukommen und um Hilfe bitten. Und so entsteht eine zweiseitige Zusammenarbeit.
JM: Zur Frage der Qualitätskriterien wollte ich noch ergänzen, dass die digitale Produktion sich doch stark von Veranstaltungen im Haus unterscheidet. Digitale Aktionen haben potenziell stärkere archivarische Spuren und die „Qualitätskontrolle“ ist demnach anders. Ich habe das Gefühl, da kommen ganz andere Dynamiken bezüglich Corporate Identity und Branding auf. Insbesondere in einem zeitgenössischen Haus sind das andere ästhetische Fragen, wenn du dein digitales Haus sozusagen selbst baust und nicht mit einer bestehenden Architektur arbeitest. Ich habe es tatsächlich schwieriger empfunden, entgegen vieler Erwartungen, mit unserer Gruppe in den digitalen Raum der Institution zu intervenieren.
AG: Ja, ich habe auch festgestellt, dass Aktionen im Haus, wie beispielsweise eine Publikumsaktivierung, leichter umzusetzen sind als digitale Formate. Leider haben die meisten Museen und Kulturinstitutionen langsame und hierarchische Entscheidungsstrukturen. Kurze Events sind manchmal leichter umzusetzen als eine Videoproduktion oder Printprodukte, die für immer lesbar bleiben.
AG: Was würdet ihr abschließen sagen, warum sollte jedes Museum ein Jugendgremium ins Leben rufen?
CC: Ich betrachte den Kontext vonseiten der Ressourcen, weil Kulturinstitutionen hauptsächlich von öffentlichen Geldern finanziert sind. In diesem Sinne bieten Kulturinstitutionen materielle Ressourcen oder Ressourcen in Form von Deutungshoheiten. Diese sollten möglichst vielen Menschen zur Verfügung stehen. Deshalb sollten möglichst diverse Gruppen von Menschen mitbestimmen können, wie sie gestaltet werden.
AG: Ich würde auch von der Ressourcenfrage aus argumentieren. Dahingehend müssen Museen nicht nur interessant sein für alle, sondern offen. Wenn Du als jüngerer, nicht-weißer, nicht able-bodied, nicht heterosexueller Mensch im Museum nicht mit Deiner Geschichte repräsentiert wirst und diese dort nicht geschrieben oder dokumentiert wird, dann möchtest Du an dieser Kultur auch nicht teilhaben oder diese besuchen. Deshalb, denke ich, dass es wichtig ist Jugendliche strukturell zu involvieren, um Ausstellungshäuser, Museen und Kultureinrichtungen dahingehend zu ändern, dass diese Gruppen dort überhaupt hingehen wollen.
JM: Ich habe ein reaktionäres Argument: Die Zwiebel. Wir wissen, übermorgen geht die Altersschere noch mal auseinander. Deswegen, denke ich, ist es besonders wichtig, die Jugendlichen aktiv zu involvieren. Wenn die Demografie der Besucher*innengruppen im Museum überaltert, dann müssen die Stimmen der Jugendlichen laut sein, gehört werden und Platz haben. Und es gibt daran anschließend das reaktionäre Argument: Die jungen Besucher*innen sind die potenziellen Museumsdirektor*innen, Sponsor*innen oder Technikdirektor*innen von morgen. Diese Personen von Anfang an in die Identität einzubeziehen ist keine Einbahnstraße. Aber andersherum kommen sie in 20 Jahren nicht zurück, wenn wir nicht zeigen, dass wir von ihnen lernen möchten und dafür entsprechende Wertschätzung zeigen.
AG: Ich finde das einen schwierigen Grundansatz, weil es eigentlich den Selbst- und Machterhalt von Institutionen verdeutlicht, die nur ihr Bestehen sichern wollen. Leider bleibt dabei meist unhinterfragt, welche Relevanz Museen für die aktuelle Gesellschaft haben. Ich fände es daher vor der Erhaltung um der Erhaltung willen wichtiger, die Relevanzfrage zu stellen: Wie können diese Kulturorte gesellschaftlich relevant bleiben? An einer Aktualisierung dieser Orte muss auch die gesamte Gesellschaft aktiv beteiligt werden.
AS: Wie Andrea schon gesagt hat, soll es ein Museum für alle sein, mit dem sich alle identifizieren können, und da gehören eben auch Änderungsprozesse dazu. Wenn Wörter, Objekte oder Abbildungen verwendet werden, die ganz konkret Personen angreifen oder verletzen, dann wird die Problematik wesentlich deutlicher, wenn junge Menschen sagen: Das wollen wir nicht! Das widerspricht unserem Selbstverständnis! Nicht, dass es deren wesentliche Aufgabe ist, eigentlich sollte es in den Häusern automatisch passieren, aber es verdeutlicht den Mitarbeitenden der Institutionen, dass es nötig ist, eingefahrene Strukturen ständig zu hinterfragen und neue Perspektiven zuzulassen und eigene Positionen infrage zu stellen. Und da wird auch der Punkt der Finanzierung der Jugendgremien wichtig, da die Personen an der Stelle ganz klar als Expert*innen tätig sind, die ihre Meinung und ihr Wissen an der Stelle einbringen.
TH: Mein Stichwort ist der Generationswechsel beziehungsweise Generationsgerechtigkeit. Demografisch liegt es nahe, dass die Menschen, welche jetzt vermehrt die klassischen Kunstmuseen besuchen, in absehbarer Zeit nicht mehr da sein werden. Und es liegt jetzt an uns, das Museum neu zu gestalten. Es soll ein Ort für alle sein und wir brauchen nicht nur die Kunst, die einfach da ist, sondern diese muss auch in den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs eingebettet sein. Ich glaube, wenn nicht nur Jugendliche, sondern generell alle Menschen als Expert*innen für ganz spezielle Gebiete gesehen werden und versucht wird, diese aktiv einzubeziehen, kann sich nicht nur die Institution und die Vermittlung insgesamt weiterentwickeln, sondern auch das ganze Selbstverständnis.
JM: Ein wichtiger Punkt, den wir nicht besprochen haben, an den Tony mich jetzt erinnert hat, sind die Kreise, die diese Jugendlichen um uns herumziehen. Und das nicht nur als klassische Multiplikator*innen gedacht, sondern auch die Veränderung, die in den Familien, in den Freundeskreisen durch unsere Arbeit stattfindet. Und das sage ich auch nicht nur so utopisch, sondern das kriegen wir in der Zeit, die wir mit ihnen verbringen, auch mit. Es wird offen darüber gesprochen, was die Jugendlichen in ihrer Freizeit im Museumsjugendgremium erleben. Dies löst wiederum Diskussionen in den Freundes- und Familienkreisen aus und das ist natürlich auch etwas, worüber wir uns sehr glücklich schätzen können, wenn die Kulturinstitution so eine Reichweite hat.
AS: Noch ein weiterer Gedanke zum Abschluss: Wenn früh vermittelt wird, dass eine Beeinflussung und Mitsprache möglich sind, dann werden auch elementare Funktionen der Demokratie erlernt. Ich glaube, das ist was ganz Essenzielles, was eigentlich gar nicht früh genug in Gang gesetzt werden kann. Die Verinnerlichung von wesentlichen Abstimmungsverfahren und demokratischen Grundfunktionen, welche dazu führen, dass eine Gesellschaft am Ende funktioniert. Und vielleicht muss die Arbeit mit den Gremien viel grundlegender gesehen werden, dass Basics mitgegeben werden, die aufzeigen, wie individuelle Mitsprache und eine Beeinflussung von Institutionen passieren kann. Ich glaube, es ist für die Zukunft der Museen ganz wichtig, dass Menschen für ihre Meinung einstehen und sich trauen, ihre Werte zu vertreten und auch aussprechen, was diese Ideen oder Utopien für das Museum sind und dass diese dann auch von den Entscheidungstragenden gehört, ernst genommen und realisiert werden. Erst dann werden die Häuser mehrdimensional und kommen in Bewegung.