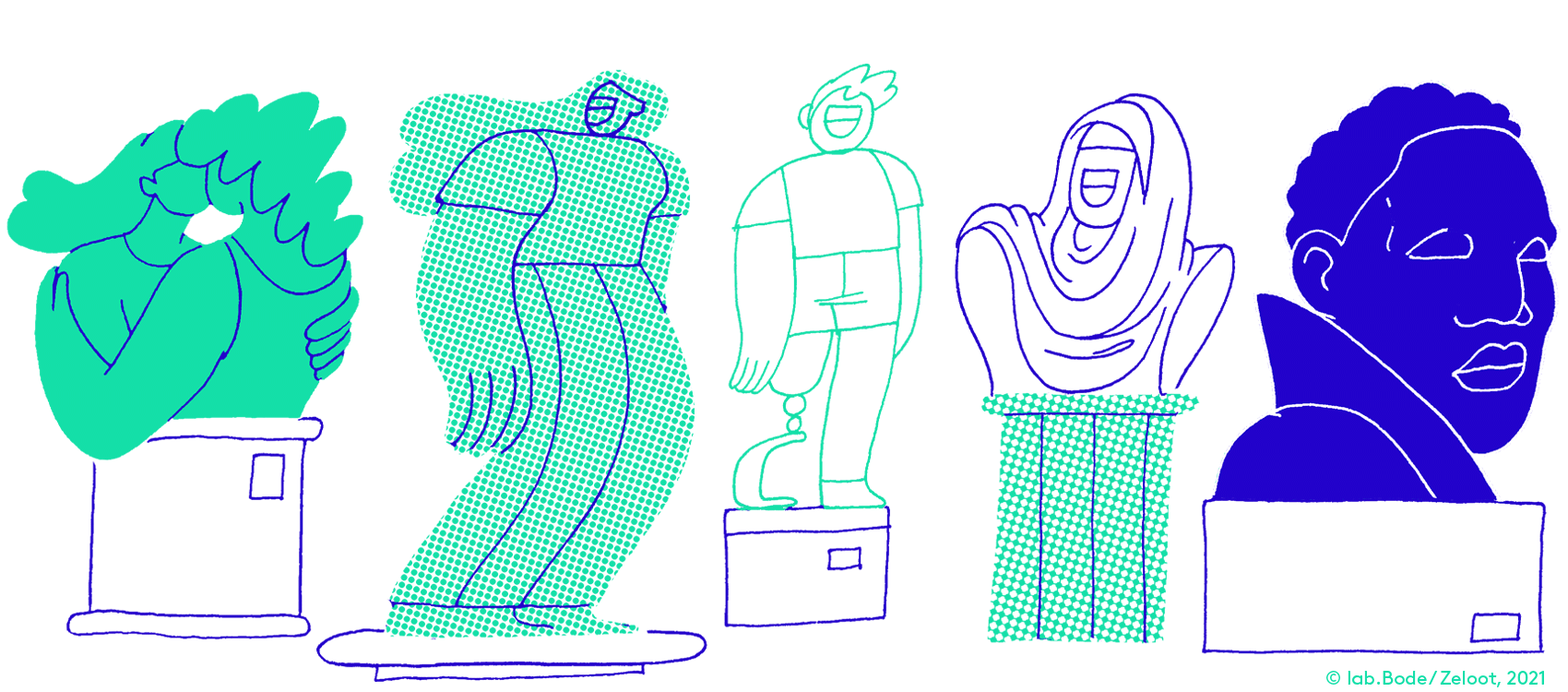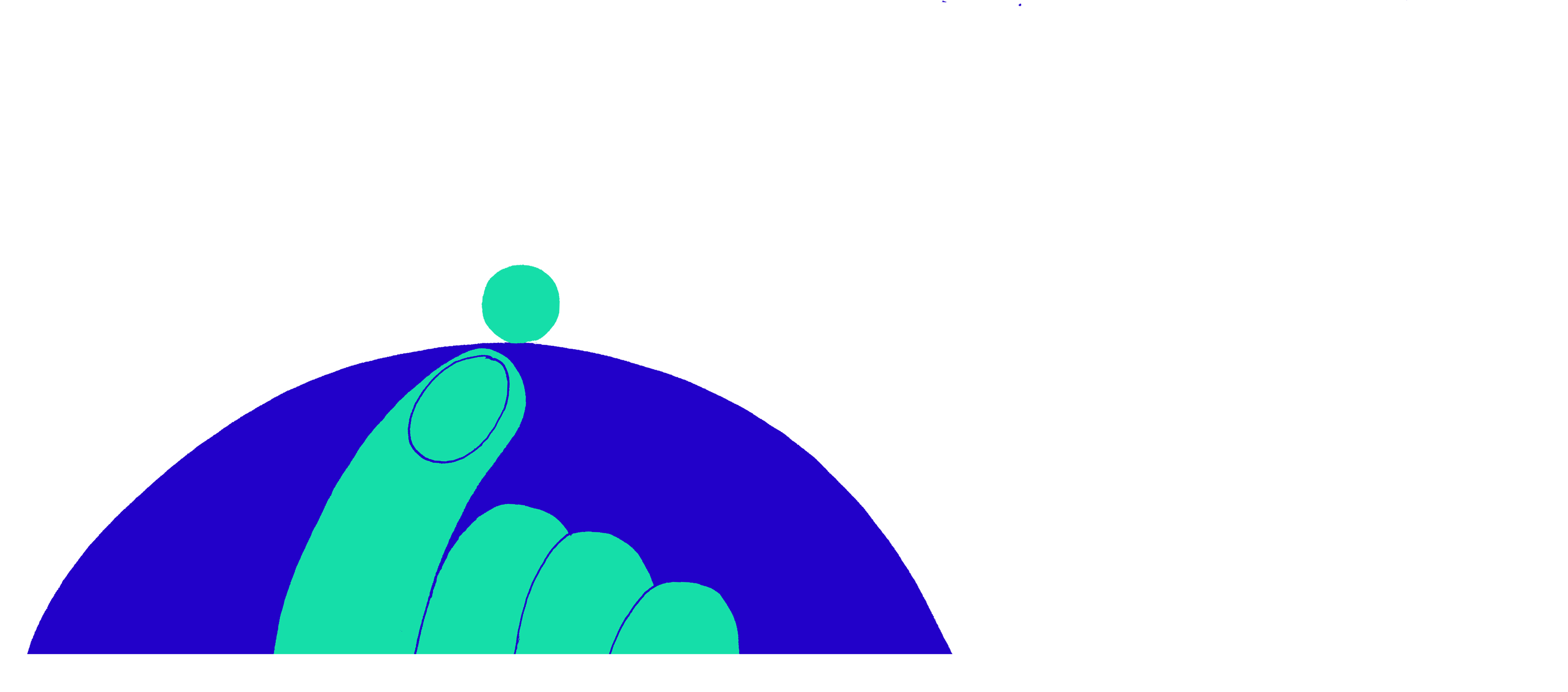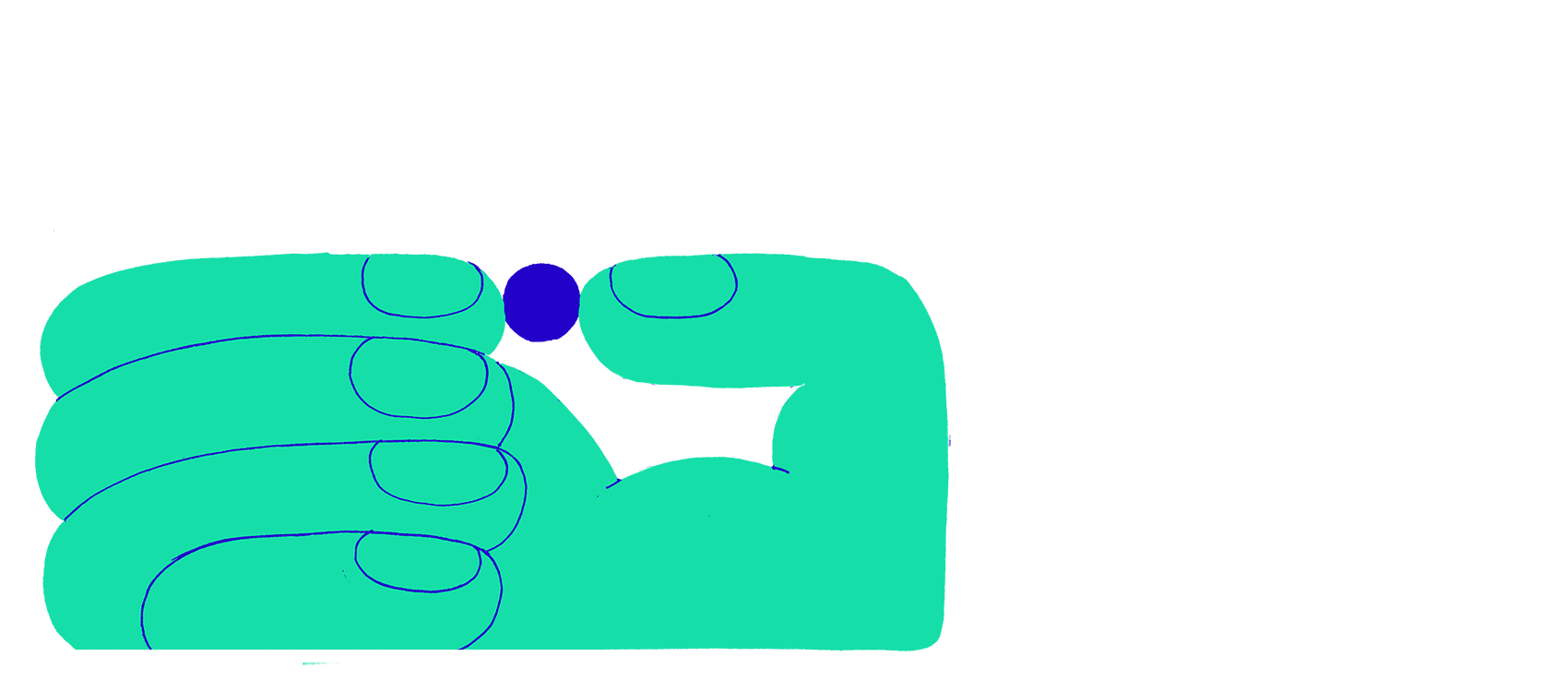Andrea Günther (AG): Ich bin 2018 auf das Netzwerk Museen Queeren Berlin aufmerksam geworden, als mich Hannes Hacke bei einer Tagung über geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen in der Bildungsarbeit angesprochen und zum nächsten Treffen eingeladen hat. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Staatlichen Museen zu Berlin, habe ich im Rahmen von lab.Bode „Let’s Talk about Sex“ entwickelt, ein Bildungsprogramm für Schüler*innen zu Gender und sexueller Vielfalt im Bode-Museum. In diesem Zusammenhang habe ich mit dem Netzwerk Museen Queeren Berlin kooperiert und auch das Bode-Museum ist Netzwerkpartner geworden. Sandra Ortmann habe ich bei den regelmäßigen Netzwerktreffen und verschiedenen Tagungen immer wieder getroffen und als kritische Kollegin kennen und sehr schätzen gelernt. Sandra Ortmann leitet jetzt die Abteilung Bildung und Outreach im Schwulen Museum und berät Museen und Kulturinstitutionen zu Fragen der diversitätsorientierten Organisationsentwicklung, zu Outreach und Vermittlung. Hannes Hacke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator an der Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität an der Humboldt Universität zu Berlin und forscht zur Präsentation von Sexualitäten in Museen. Ende Dezember 2020 habe ich beide zum Gespräch über die Arbeit des Netzwerk Museen Queeren Berlin getroffen.
AG: Hallo! Beschreibt doch mal, was ist das Netzwerk Museen Queeren Berlin?
Sandra Ortmann (SO): Im Netzwerk Museen Queeren kommen Menschen zusammen, die in oder mit Museen und Gedenkstätten arbeiten und sich über Fragen von Geschlecht und Sexualität und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Inter* und Queers (LSBTIQ) in Museen auseinandersetzen, sei es im Bereich der Sammlungen, in Ausstellungen, in der Vermittlung, im Personalbereich. Wir treffen uns viermal im Jahr in verschiedenen Museen und tauschen uns über Best-Practice-Projekte oder einen thematischen Schwerpunkt aus. Einmal im Jahr organisieren wir eine öffentliche Veranstaltung mit Gästen. Wir sind ein selbstorganisiertes Netzwerk ohne finanzielle Förderung, das von denen lebt, die daran teilnehmen und sich engagieren. Wir haben eine Webseite mit Materialien zu LSBTIQ und Museen und einen zentralen E-Mail-Verteiler.
AG: Ich erinnere mich besonders an zwei Veranstaltungen: Eine in der Berlinischen Galerie und eine im Märkischen Museum (Stiftung Stadtmuseum Berlin). Was ich gut fand im Stadtmuseum, war, dass unter anderem der Direktor dabei war. Er hat das Netzwerk begrüßt und die Veranstaltung in seinem Haus willkommen geheißen. Ich finde, das ist ein ziemlich wichtiger Teil, so auch die Leitungsebene von Institutionen als Unterstützer*innen für das Netzwerks zu gewinnen.
SO: Ja, wir bemühen uns immer, in jedem Museum, in dem wir uns treffen, uns auch den Abteilungen vorzustellen.
AG: Seit wann gibt es das Netzwerk und wie kam das Ganze zustande?
Hannes Hacke (HH): Das Netzwerk ist 2016 entstanden im Nachgang der Ausstellung Homosexualität_en, die im Deutschen Historischen Museum (DHM) und Schwulen Museum gezeigt wurde. Ich habe damals mit meiner Kollegin Katja Koblitz, die inzwischen Leiterin des Spinnboden Lesbenarchivs ist, im Schwulen Museum gearbeitet, und wir haben eng mit der Vermittlungsabteilung des DHM zusammengearbeitet. Nach der Ausstellung gab es ein Treffen, um die Zusammenarbeit auszuwerten. Daraus ist dann die Arbeitsgemeinschaft „Sexuelle und Geschlechtliche Vielfalt“ entstanden. Im Laufe der folgenden zwei Jahre sind dann immer mehr Teilnehmer*innen dazugekommen. Ich war sehr inspiriert von dem Queering the Collections-Netzwerk in den Niederlanden, das in ganz ähnlicher Weise versucht, Sammlungsinstitutionen und Museen zu vernetzen. Wir haben sie eingeladen, uns von ihren Aktivitäten und Arbeitsweisen zu berichten und das hat dann auch dazu geführt, dass wir unseren Namen geändert haben, in Netzwerk Museen Queeren Berlin. Das Verb „queeren“ haben wir aus dem Englischen („queering“) übernommen. Dahinter steht die Idee, queeren als eine aktive Praxis zu verstehen. Es geht also nicht nur darum, mit diesem Netzwerk die Sichtbarkeit von LSBTIQ in Museen zu stärken, sondern auch heteronormative Strukturen und binäre Sexualitäts- und Geschlechternormen zu hinterfragen. Ich finde es wichtig, deutlich zu machen, dass das kein abgeschlossener Vorgang ist, und dass auch die Frage, was „queeren“ eigentlich ist, immer wieder neu verhandelt werden muss.
AG: Sandra, was wollt Ihr mit dem Netzwerk erreichen?
SO: Eines der zentralen Ziele ist der Austausch, die Vernetzung, die gegenseitige Stärkung und Strategieentwicklung sowie eine Einigung auf Standards. Grundlegend würde ich sagen, ist es wichtig festzustellen, dass es in den Museen, wie sie heute in Berlin existieren, eine Dominanz der Geschichten über Männer gibt und eine Unterrepräsentation von Frauen, von trans* Personen und inter* Personen. Die Geschlechter sind nicht gleichwertig repräsentiert und ihre Geschichten werden nicht gleichermaßen gesammelt. Wenn sie dargestellt werden, gibt es immer wieder Stereotype, unter denen sie verhandelt werden: beispielsweise gibt es bei trans* und inter* Personen einen medizinischen Diskurs, in dem sie auf eine Leidens- oder auch eine medizinische Geschichte reduziert werden und nicht als handelnde politische Menschen sichtbar werden. Die Geschichte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, trans* und inter* Personen ist insgesamt eine unter-erzählte Geschichte. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass queer nicht nur schwule Männer meint, sondern über Geschlecht und sexuelle Orientierung hinausgeht. Es ist ursprünglich ein Schimpfwort für Menschen, die nicht einer heterosexuellen, zweigeschlechtlichen monogamen Norm entsprechen. Es geht auch um Menschen, die Sexarbeit machen oder die BDSM praktizieren, um Klasse und Rassismus, um Schwarze, migrantische, QTBIPOC, Bisexuelle, trans* und inter* Personen. Das ist etwas, was häufig im Diskurs über queer unter den Tisch fällt: der intersektionale Blick auf Sammlungen, Ausstellungen und Institutionen. Ohne den geht es einfach nicht. Wir haben Museen, die in einer rassistischen, kolonialen Tradition stehen, die immer mit Geschlecht und Sexualität verschränkt sind. Also in dem Sinne möchte ich queeren als Teil einer dekolonialen und emanzipativen Praxis verstehen.
HH: Ja, „queeren“ bedeutet nicht nur eine bessere Repräsentation von der Vielfalt von Sexualität und Geschlecht, sondern es geht darum, heteronormative und binäre Setzungen infrage zu stellen. Und das ist nicht nur auf Ausstellungen bezogen oder auf das, was an die Öffentlichkeit kommuniziert wird, sondern betrifft alle Bereiche des Museums. Der Netzwerkcharakter von Museen Queeren Berlin bedeutet aber auch, dass Leute mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was queeren heißt, zusammenkommen. Für die einen liegt der Schwerpunkt stärker darauf, eine größere Sichtbarkeit für bi, trans*, schwule, lesbische und inter* Geschichte, Identitäten und Kunst herzustellen. Andere setzen stärker auf eine Kritik an Kategorisierungen und den Mechanismen der „Inklusion“ und eindeutiger Sichtbarkeit im Museum. Es gibt unterschiedliche Strategien und ich denke, diese Vielfalt der politischen und inhaltlichen Positionen zeichnet das Netzwerk auch aus.
AG: Wer ist eingeladen, das Netzwerk mitzugestalten und wer nimmt denn tatsächlich an den Netzwerktreffen teil?
SO: Also, Leute kommen aus verschiedenen Denktraditionen und Richtungen. Ich komme aus einer queeren Praxis und einer queeren Alltagsrealität. Für manche ist das Engagement stärker mit einem theoretischen oder historischen Interesse verbunden. Das ist ja auch eine Qualität, dass wir sehr unterschiedliche Leute ansprechen, aus großen und kleinen Museen, Archiven und Gedenkstätten. Manche leiten Abteilungen, andere arbeiten in der Vermittlung, andere wiederum an der Uni, andere sind Freiberufler*innen, die Workshops geben, kuratorisch oder wissenschaftlich arbeiten. Es kommen auch immer wieder Volontär*innen, die ihre Institutionen verändern wollen. Eingeladen sind erst mal alle, die sich von unseren Zielen angesprochen fühlen.
HH: Oft sind es auch junge Mitarbeiter*innen, Volontär*innen oder Personen aus dem Mittelbau des Museums, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen und dann auf das Netzwerk stoßen und sich mit uns für ein einzelnes Projekt vernetzen. Da gibt es dann Lernprozesse, die wir mit dem Netzwerk begleiten. Es gibt Personen, die kontinuierlich dabei sind, auch weil sie die Möglichkeit haben, das in ihrer Arbeitszeit zu tun. Das Jugendmuseum in Schönberg hatte zum Beispiel das mehrjährige Modellprojekt „All included“ durchgeführt, das im Verlauf immer wieder vorgestellt und diskutiert wurde. Bei anderen Museen ist es so, dass mal ein einzelnes Projekt zu LSBTIQ gemacht wird und das war’s dann, dann wird zum nächsten Thema übergegangen. Denn so funktionieren ja leider auch oft Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Prekäre Arbeitsbedingungen und befristete Verträge verstärken das. Ich finde aber, die Qualität des Netzwerks ist, dass dieses Wissen und die Erfahrungswerte nicht verloren gehen, sondern geteilt werden und im besten Fall die Personen auch im Netzwerk bleiben und sich weiter einbringen.
AG: Ja, das ist eine Frage: Greift man nur Expertise und Wissen ab oder gibt man das Erlernte und seine eigenen Erfahrungen wieder zurück ins Netzwerk und lässt andere daran teilhaben? Inwieweit denkt Ihr, dass das Netzwerk Museen Queeren Berlin zu einer diskriminierungskritischen Arbeit im Museum beitragen kann?
HH: Diskriminierungskritische Arbeit ist ein Teil von Museen Queeren Berlin. Zum einen vernetzt, bestärkt und empowert es Personen, die sich vielleicht allein in ihrem Museum mit diesem Thema beschäftigen und sonst nicht viele Verbündete haben, um diese Themen anzugehen. Und es ist auch ein Raum, um Diskriminierung zu thematisieren, die wir selber erfahren oder die an unseren Museen passieren. Das Netzwerk trägt zum anderen dazu bei, vielfältige Expertisen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen und Austausch und Kritik untereinander zu ermöglichen. In der täglichen Museumsarbeit hat man ja selten die Möglichkeit, eigene Projekte – Ausstellungen, Sammlungsinitiativen, Vermittlungskonzepte – unter Kolleg*innen zur Diskussion zu stellen und die eigene Praxis kritisch zu hinterfragen. Ich denke, das trägt dazu bei, einen diskriminierungskritischen Blick zu schärfen, Auslassungen zu hinterfragen und zum Beispiel Kooperationen anders zu gestalten. Ich würde sagen, das Netzwerk trägt dazu bei, queere Themen in einer intersektionalen Perspektive als ein Teil diskriminierungskritischer Arbeit im Museum sichtbar zu machen.
SO: Es ist angenehm, einen Ort des Austauschs zu haben, an dem kollegial miteinander umgegangen wird. Viele Räume, Konferenzen und besonders Universitäten und Hochschulen sind ja sehr stark von Konkurrenz geprägt. Und dass es im Netzwerk eher ein gegenseitiges Unterstützen ist, empfinde ich als sehr positiv. Manche von uns arbeiten ja auch in heteronormativeren Settings als dem Schwulen Museum und sind ganz froh, wenn sie einfach mal in einem Raum sind mit anderen museum professionals, die verstehen, wovon gesprochen wird.
AG: Das, was ihr gerade benannt habt, sind genau die Elemente, wovon auch das lab.Bode und das Bode-Museum profitieren konnten. Auch ich persönlich, als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Staatlichen Museen zu Berlin, habe die Expertise und Unterstützung des Netzwerkes als extrem bereichernd erfahren. Für mich war die Arbeit im Netzwerk ein Empowerment-Prozess, der mich ungemein in der Idee bestärkte, ein queeres Bildungsprogramm im Bode-Museum zu entwickeln. Oft ist man gerade in kulturhistorischen Museen die erste, die probiert, solche Themen dort zu platzieren. Es gibt nicht sehr viele Kenntnisse oder Referenzen und oft wenig Expertise oder Bewusstsein im Haus, wenn man anfängt, so ein queeres Programm aufzubauen. Deshalb ist das wahnsinnig recherche- und forschungsintensiv, was man oft kaum in seinem Stellenvolumen leisten kann. Daher war ich total dankbar, auf das Netzwerk zu treffen. Es hat mir zum einen eine tolle freie Mitarbeiterin vermittelt, mit der ich „Let’s Talk about Sex!“ zusammen aufgebaut habe. Darüber hinaus war es ein Gewinn, dieses Bildungsprogramm dem Netzwerk vorstellen zu können und eine zugewandte, aber sehr kritische kleine Öffentlichkeit zu haben, um Feedback zu bekommen. Das Netzwerk ist ein ziemlich großer Pool an Expertise und Bestärkung. Das leistet das Netzwerk sehr gut, diesen – tatsächlich auch wissenschaftlichen – Austausch. Also danke dafür, es war spitze, auf das Netzwerk zu treffen!
HH: Danke Dir für Dein Engagement!
AG: Inwieweit kann das Netzwerk vielleicht auch strukturelle Veränderungsprozesse in Institutionen anstoßen oder sogar verankern?
SO: Ich finde, da hat das Netzwerk noch viel Potential. Aber die Tatsache, dass viele sich neben ihren eigentlichen Jobs engagieren, erschwert es ein bisschen. In der letzten Sitzung haben wir zum Beispiel mit Eylem Sengezer von Diversity Arts Culture und der Organisationsentwicklerin Lena Prabha Nising über diskriminierungskritische Personalpolitik gesprochen. Da ging es viel um Standards. Worauf muss man achten bei Ausschreibungen? Wie muss eine Betriebskultur aussehen, damit „diverse“ Leute nicht nur eingestellt werden, sondern dann auch bleiben? Ein anderes Mal haben wir über einen Leitfaden zu geschlechtergerechter Sprache von der Berlinischen Galerie diskutiert, der dann auch ein Vorbild sein kann für andere Häuser. Ich denke, dass wir in den Diskussionen über den nötigen Wandel der Museen in Berlin eine Stimme haben. Und wir schauen auch auf die gute Arbeit anderer kulturpolitischer Initiativen wie Berlin Postkolonial, Diversity Arts Culture, Berlinklusion und anderen.
AG: Ich fand die Netzwerkbeteiligung des Bode-Museums und von lab.Bode einen spannenden Prozess. Anfänglich habe ich als interessierte wissenschaftliche Mitarbeiterin am Netzwerk teilgenommen, aber das Bode-Museum stand noch nicht offiziell auf der Website des Netzwerks. Dann habe ich den Direktor des Museums gefragt, „Gibt es ein Bekenntnis, sind wir offiziell Teil des Netzwerkes?“ Und das heißt ja auch, das Museum bekennt sich zumindest zu einer Auseinandersetzung oder zu dem, was in dem Positionspapier des Netzwerks steht. Diese Themen in das Bewusstsein zu rücken, auch in Leitungsebenen von Institutionen, finde ich ganz wichtig. Ich finde, das können wir noch besser und stärker machen.
SO: Und gleichzeitig finde ich wichtig, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen, weil es immer wieder auch Versuche gibt, von uns irgendwie ein Gratis-Programm zu bekommen. Also dass man auch eine Unabhängigkeit als Netzwerk behält.
HH: Ich würde auch sagen, dass es ambivalent ist. Wir machen ja jährlich eine große Veranstaltung in einem der beteiligten Museen und bringen damit ja auch die Museen dazu, Stellung zu beziehen. Dieses Bekenntnis zu diesem Thema kann dann wiederum von den Mitarbeiter*innen, die im Museum für Veränderungsprozesse kämpfen, genutzt werden. Das Netzwerk kann Museen aufzeigen, dass sie etwas dadurch gewinnen – so neoliberal das klingt –, sich diskriminierungskritisch zu positionieren und andererseits aber auch einfordern, dass es strukturelle Veränderungsprozesse gibt. Es ist sehr einfach für ein Museum zu sagen, wir sind Teil des Netzwerks, da gehört nicht viel dazu. Man kann es auf die eigene Webseite schreiben, aber gleichzeitig gar keine Ressourcen in das Netzwerk geben oder die Mitarbeiter*innen, die für die Institution an dem Netzwerk teilnehmen, trotzdem nicht in den Veränderungsprozessen unterstützen. Das ist eine Spannung, mit der wir umgehen müssen und wollen.
SO: Mit Corona haben wir jetzt überlegt, dass wir, wenn wir uns online treffen – was wir erstmal als Nachteil wahrgenommen haben – ja eine viel höhere Reichweite haben und auch Leute aus anderen Städten teilnehmen können. Die Diskurse sind auch wichtig für Leute, die relativ vereinzelt in kleinen Institutionen auf dem Land oder anderen Städten arbeiten. Das wollen wir in nächster Zeit stärker angehen, wie wir mehr Leute erreichen, bundesweit und im deutschsprachigen Ausland. Es ist auch eine Herausforderung, dass wir nicht wissen, wie es kulturpolitisch nach Corona weitergeht. Wenn die politische Lage sich ändert, dann könnten diese Themen wieder stärker marginalisiert werden.
HH: Generell versuchen wir weitere Museen in Berlin dazu zu bewegen, sich kontinuierlich an dem Netzwerk zu beteiligen und sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ein weiteres Ziel ist das Verknüpfen mit anderen Initiativen für Veränderung im Museumsbereich in Berlin, also zum Beispiel der dekoloniale und behinderungspolitische/DisabilityAktivismus. Wir wollen uns als Netzwerk stärker mit diesen Akteur*innen vernetzen und schauen, wie diese Themen bei Museen Queeren ein Rolle spielen und andersherum. Auch die Diskussionen, die derzeit in den Museen unter dem Begriff Gender geführt werden, sind für uns natürlich wichtige Bezugspunkte.
AG: Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?
HH: Ich finde, eine bleibende Herausforderung ist der Mangel an Beschäftigung mit queeren Themen in Berliner Museen. Angesichts der langen Geschichte des queeren und feministischen Aktivismus und der großen LSBTIQ Community in Berlin ist die geringe Anzahl der Berliner Museen, in denen diese Themen explizit verhandelt werden, immer noch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde mir wünschen, dass das nicht länger als Randthema angesehen wird, sondern als Querschnittsaufgabe.
SO: Und dass nicht nur Opfergeschichten erzählt werden. Wir interessieren uns nicht nur für die Verfolgten und Geschlagenen, wir interessieren uns auch für die, die leben, queer lieben, kämpfen und glücklich sind.
AG: Vielen Dank für das Gespräch!
Interessierte können sich auf der Website www.museen-queeren.de über die nächsten Treffen, aktuelle Termine und Materialien zu LSBTIQ* und Museen informieren. Kontakt: info[a]museen-queeren.de